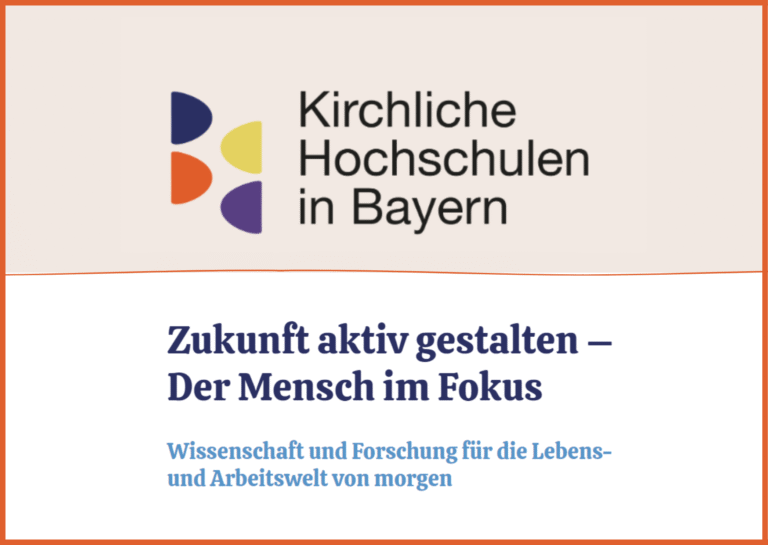Lena Schützle und René Pikarski hatten während eines Workshops des Doktorandenkollegs von Prof. Dr. Michael Reder an der Hochschule für Philosophie München am 27. Juni 2025 die Chance, mit dem Soziologen Prof. Dr. Hartmut Rosa von der Friedrich-Schiller-Universität Jena ins Gespräch zu kommen. In dieser Themenreihe berichten sie von ihrem Austausch.
Zum Beitrag von René Pikarski
Von Lena Schützle
Der Soziologe Prof. Dr. Hartmut Rosa besuchte die Hochschule für Philosophie München am 26. und 27. Juni 2025. Am Abend präsentierte er in gewohnt eindrucksvoller Weise zentrale Thesen seines Resonanzkonzepts und lud das Publikum zur Reflexion über das Verhältnis zwischen Subjekt und Welt, aber auch zwischen Solidarität, Verantwortung und Resonanz ein. Die anschließende Diskussion zeigte, wie sehr sein Ansatz zum Denken anregt – nicht nur in akademischen Kontexten, sondern weit darüber hinaus.
Am darauffolgenden Vormittag hatten wir die besondere Gelegenheit, im Rahmen eines Workshops mit dem Promotionskolloquium von Prof. Dr. Michael Reder intensiver mit Hartmut Rosa ins Gespräch zu kommen. Michael Reder ist Vertreter der Praktischen Philosophie und befasste sich in vielen Forschungsprojekten mit politischer Solidarität und Vulnerabilität, zudem ist er seit 2025 Mitglied im Leitungsgremium des Kollegs Zeichen der Zeit lesen. Zwei der philosophischen Impulsgeber:innen, René Pikarski und ich, sind Mitglieder dieses Promotionskollegs und erhielten die Möglichkeit, jeweils eine kritisch-konstruktive Antwort auf Rosas Werk zu formulieren.
Im Folgenden skizziere ich einige zentrale Themen, die in unserem Austausch aufkamen, und teile, was mir besonders in Erinnerung bleiben wird.
Ich selbst näherte mich Hartmut Rosas Resonanztheorie aus einer phänomenologisch-buddhistischen Perspektive. Ausgehend vom Konzept der Leere – verstanden als die Einsicht, dass nichts ein separates, unveränderliches Selbst besitzt – stellte ich die Frage, wie Mitgefühlstheorien sowie Hartmut Rosas Resonanzkonzept politisch gewendet werden könnten. Die Philosophie der Leere ermöglicht es, Widersprüchliches nebeneinander stehen zu lassen, ohne es auflösen oder vereinheitlichen zu müssen. Damit bietet sie nicht nur einen alternativen Zugang zum Mitgefühl, sondern auch eine Möglichkeit, die Resonanztheorie zu „ent-romantisieren“: Statt idealisierter, normativer Weltbeziehungen rücke sie die Ambivalenzen, Spannungen und Kontexte in den Vordergrund. Zudem regte ich an, kritisch-phänomenologische Ansätze – etwa im Anschluss an Maurice Merleau-Ponty oder Sara Ahmeds neuere feministische Phänomenologie – als Brücke zwischen Resonanz und Mitgefühl zu denken, insbesondere in Bezug auf politische Subjektivierung und Relationalität.
Neben dem sich daraus ergebenden Gespräch, waren die Beiträge der anderen Impulsgeber:innen eine wahre Bereicherung für mich. René Pikarski, der sich in seiner Dissertation mit dem Konzept der Intuition befasst, setzte sich vertieft mit Rosas Begriff der “Unverfügbarkeit” und der “Ahnung“ auseinander. Er fragte, inwiefern Ahnungen als vorreflexive Formen der Wahrnehmung von Resonanzerfahrungen verstanden werden können, und ob sie auch Formen intuitiver Erkenntnis beinhalten. Sein Beitrag kann hier nachgelesen werden.
Einen weiteren wichtigen Beitrag lieferte Veronika Hilzensauer, die zu Hannah Arendts Werk aus relationstheoretischer Perspektive forscht. In ihrer Intervention formulierte sie präzise, kritische Anfragen an Hartmut Rosas Resonanzbegriff, insbesondere im Hinblick auf politische Handlungsfähigkeit, Verantwortung und die grundlegende Relationalität in pluralen Gesellschaften. Inwiefern führt Resonanz als monistisches Kriterium für das gute Leben in eben dieser theoretischen Grundlegung zu einer Verengung des Spektrums von (kritisierbaren) Beziehungen?
Danilo Gajic knüpfte an Forschungsprojekte am Lehrstuhl an und fragte nach Hartmut Rosas Begriff der Verletzlichkeit. Wo ist der Unterschied zwischen Berührbarkeit und Verletzlichkeit? Und geht es am Ende nicht auch darum, nicht nur ein gutes Leben zu führen, sondern auch darum, überhaupt überleben zu können?
Die Diskussionen verliefen in einer ausgesprochen wohlwollenden Atmosphäre. Hartmut Rosa erwies sich dabei als äußerst offen, resonanzfähig und zeigte Interesse an den aktuellen philosophischen Debatten. Für mich war es bestärkend, mein eigenes Forschungsthema anzubringen und so viele, sinnvolle Anknüpfungspunkte zu entdecken. Auch wenn das philosophische Arbeiten – zumindest in der Dissertationsphase – ein einsames Unterfangen sein kann, scheinen wir doch nie ganz allein mit unseren Anliegen zu sein. Umso spannender, wenn der eigene Beitrag von Kolleg:innen als Bereicherung wahrgenommen wird.
Unser Treffen mit Hartmut Rosa bleibt als ein besonders inspirierender Moment wissenschaftlicher Begegnung in Erinnerung – als ein Beispiel dafür, wie produktiv Resonanz auch in der akademischen Kommunikation wirken kann.