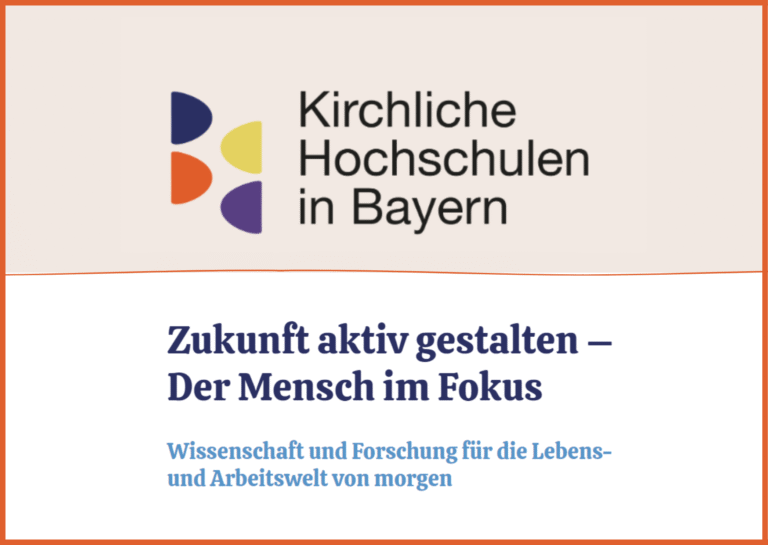Jean-Luc Godard meint, wie wir die Vergangenheit darstellen, verrate viel darüber, wie wir die Gegenwart sehen. Und für den Blick in die Zukunft vermuten Margaret Atwood und Ursula K. Le Guin, dass auch alle Science-Fiction in Wahrheit von den Sorgen und Hoffnungen im Hier-und-Jetzt handelt. In unserem Blog-Duett sprechen René Pikarski und Hannah Berger über Filme, deren noch so “ferne” Motive uns durch die aktuellen Herausforderungen der Gesellschaft stets auf neue und andere Weise näher rücken und (etwas) angehen können. Dabei gibt es nur ein wenig Spoiler-Alarm, dafür aber den ein oder anderen Tipp für den nächsten Filmabend.
Nachtrag zu einem Gespräch mit dem Regisseur Michael Kann anlässlich der Vorführung seines Films »Stielke, Heinz, fünfzehn…« auf den DEFA-Filmtagen in Merseburg
Von René Pikarski
Zugegeben, nur wenige Leute fanden den Weg in den zu Unrecht fast vergessenen DEFA-Spielfilm, der von den Erlebnissen eines überzeugten Hitlerjungen erzählt. Davon, wie er im letzten Kriegsjahr gesagt bekommt, er sei »Halbjude« und daraufhin vom Gymnasium gejagt wird.[1] Der Film beruht auf dem biografischen Roman von Wolfgang Kellner,[2] den die Filmschaffenden damals schon vor Veröffentlichung zur Adaption erhielten. Er erzählt vom seltsam unerhörten Glück, wie einen die eigene Ideologie manchmal auf ziemlich unglückliche Weise davon abhält, zu ihrem Täter zu werden.
Für mich gehört der Stielke-Film zu den gut gealterten Babelsberger Produktionen. Das soll kein vergiftetes Kompliment sein. Ich meine nicht, dass er »zeitlos« ist, sondern sich vor dem Hintergrund gegenwärtiger Ereignisse mit stets neuen Nuancierungen und Färbungen durch die jeweiligen Zeichen unserer Zeit aktualisiert. Man sieht ihn immer etwas anders. Heute etwa, nicht zur Premiere im Berliner Colosseum 1987, sondern nach der Veröffentlichung einer Kriminalstatistik, die jüngst mit 5.000 gemeldeten Fällen eine Verdopplung antisemitischer Straftaten in Deutschland feststellt.[3] Heute, nicht zur Filmhandlung 1944, wo an unseren Schulen laut einer aktuellen Studie[4] »Du Jude!« weiterhin eine verbreitete Beleidigung ist. Heute, wo diese Studie von einer Schülerin berichtet, die auf dem Schulhof mit »Heil Hitler!« begrüßt wird und ein jüdischer fünfzehnjähriger Junge hört, er solle »wie seine Verwandten ins Gas gehen«. Heute, wo uns viele Zeitzeug:innen altersbedingt immer seltener zur Verfügung stehen, die ihre Ausgrenzung an den Schulen im »Dritten Reich« und den anschließenden Weg in die Illegalität als das prägendste Ereignis erinnern, mit dem ihre Biografie bereits in jungen Jahren gebrochen wurde.[5]
Von so einem Bruch in der Biografie handelt der Film. Er warnt uns aber mit all seinen Gestaltungsmitteln vor dem Vorurteil, sich diesen Bruch als Riss zwischen dem alten und dem neuen Leben, als plötzliche Unterbrechung oder unendliche Leere vorzustellen, in der alles stillsteht und gar kein Leben mehr stattfindet. Man lebt ja einfach. Die Brüche haben eine eigene, ungewisse Dauer, die selbst voller Leben sind. Ihre Ereignisse werden so intensiv und kurzweilig, dass die Zeit fehlt, um dem alten Leben hinterher zu trauern oder von einem neuen »Leben träumen zu können«, wie es im diesjährigen Motto der Filmtage hieß. Weiß man denn in solchen Augenblicken gerade so viel, wie es bräuchte, um überhaupt von einem anderen Leben zu träumen? Weiß man in diesem Moment genug von den großen historischen Entwicklungen, in die man da verwickelt wird? Weiß man oder kann man nur intuitiv ahnen, was man im Leben gerade verloren hat? Worauf man noch hoffen kann? Was es an Selbstverständlichem und Bekanntem nicht mehr geben dürfte, was am so fanatisch Geglaubten, am ach »so richtig Deutschen« spürbar falsch und widersprüchlich wird und wie das »jüdische Leben« nur noch in seiner Negativität erscheinen kann, als das Andere, Abwesende, Diffamierte und Stigmatisierte, Zu-Verheimlichende und Zu-Versteckende? Und selbst wenn man nicht weiß, was all das mit einem zu tun hat, muss man trotzdem ein Leben leben, das davon betroffen ist.
Zu so einem Leben gerät das vom Rottenführer Heinz, dessen hübsche »arische Nase« sich eben noch aufrecht im Hitler-Porträt spiegelte und dessen Vater aufgrund seiner »Herkunft« nun plötzlich nicht mehr als in der Ukraine gefallener Kriegsheld im Klassenzimmer verehrt werden kann: »Juden raus«; widerlich antisemitische Schmierereien an der Tafel; die einstigen Freunde wie eine Mauer gegen Heinz gestellt. Zur Ouvertüre seines unfreiwilligen »Abenteuers« wird die Geste der Unsichtbaren. Instinktiv zuckt er zusammen, duckt sich, schleicht hinter der Litfaßsäule nach Hause, sein paranoider Blick in die Umwelt gilt allein dem Aufspüren all der Blicke, die ihn wohl erblicken könnten. Das letzte Kriegsjahr wird zur Odyssee durch ein zunehmend desillusioniertes Land. Vorbei am Grauen, durch dessen Alltag und seine Gewöhnung. Entlang seiner Bürokratie der gehobenen Hände, die längst in sich zusammengesackt nur tranceartig wiederholen kann, »dass man nun auch nichts mehr machen kann«. Heinz‘ Begegnungen mit den meisten Nazis bleiben grotesk. Faschistisch begeistert sind eigentlich nur noch die abgerichteten Kinder. Nicht die in den Deportationszügen, die unsichtbar an Heinz vorbeirollen, sondern das von der Wehrmacht einverleibte, fröhlich vor dem Stimmbruch singende Kanonenfutter auf der Fahrt zur Front. Aber die »Alten«? Die erwachsenen, gestandenen Nazis sind meistens Subalterne des Regimes: Ein Kommissar, der längst nicht mehr aufrecht sitzen kann, kauert deformiert hinterm Schreibtisch; seine lupendicke Brille lässt zweifeln, ob er je den »Endsieg« sehen konnte. Ein Lagerleiter, der sich betrunken, verschwitzt und schmierig mit seiner Kameradin den zynischen und selbstbetäubenden sadosexuellen Missbrauch der eltern- und heimatlosen Jungs aufteilt. Subalterne Figuren in den unheimlichen Heterotopien einer untergehenden Gesellschaft all der Weg‑, Gegen- und Mitlaufenden, aber auch der nur beiläufigen und unterläufigen Täterinnen und Täter, die auf so lächerlich zufällige Weise in den kleinsten Nischen und kaum beachteten Orten die psychische Macht und physische Gewalt ausüben können, um ein junges Leben für immer zu prägen.
Erst allmählich wird die Reise von Heinz zu einem Aufbruch seiner eigenen nationalsozialistischen Überzeugung. Ein Aufklärungsmoment ist nicht das fertige Wissen oder endlich ein umfassender Überblick über all die Lügen und Verbrechen. Eher ist es das naiv-ehrliche Durchsickern, mit dem Heinz seinen Kameraden irgendwann fragt, ob die »Alten« ihn mit ihren antisemitischen, völkischen Ideen und den Versprechen von Krieg und Liebe »einfach nur beschissen haben«?
Der Satz fällt durch die herrlich unbedarfte, freche Berliner Schnauze von Hauptdarsteller Marc Lubosch. Er spricht ihn nicht aus wie ein Urteil, sondern als Hypothese, deren Wahrheit erst die Zukunft zeigen wird: »Kann es sein, dass die Alten uns beschissen haben?« ist eine intuitive Frage jener Generation, in der die Alten, die Väter, oft abwesend waren. Jene Generation, die heute oft als die um ihr Leben »betrogene« Generation benannt wird. Ein mutiges Motiv des Films besteht darin, dieser Generation damit nicht gleich ganz abzusprechen, überhaupt gelebt zu haben: die Pubertät etwa, die Entdeckung der eigenen Sexualität, die Freundschaft unter Ausgeschlossenen, finden ja trotzdem statt und erzwingen sich Räume auch in den disruptiven, unheimlichen also heimatlosen, entmenschlichenden Lebensformen eines totalen Vernichtungskriegs. Dies als »Alltag im Krieg« zu bezeichnen, steht mir nicht zu. Mit den Motiven im Film kann ich aber mitvollziehen, wie intensiv das Leben und wie sich dessen Tragik und Komik ausgerechnet dort verflechten können, wo es gefährdet und in der Krise ist.
Weil die Erkenntnis vom »Beschiss« durch die Alten erst langsam kommt, bleibt die klare und eindeutige Festlegung von Verantwortung und Schuld des Einzelnen im Regime für die Dauer des Films in der Schwebe. Damit steht »Stielke« in einer bestimmten Tradition innerhalb des DEFA-Studios für Spielfilme. Keine Frage: Eine antifaschistische Aufgabe zur Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen gehört zur Babelsberger DNA seit 1946. Man denke nur an die erste Regie-Generation der DEFA, an die Filme von Kurt Maetzig, Wolfgang Staudte und Slatan Dudow.[6] Das aber heißt nicht, dass ein junger Nazi – einer, der es nicht besser wusste – zu jeder Zeit und unter jedem kulturpolitischen Dispositiv der DDR und in der volkseigenen Filmproduktion in Konkurrenz zu deren großen positiven Widerstandshelden im historischen Spielfilm treten konnte. Ein Pionierfilm, der dies 1964 aufbrach, ist »Die Abenteuer des Werner Holt« (Joachim Kunert), in dem sich junge deutsche Soldaten im Himmelfahrtskommando mit Panzerfaust vor den vorrückenden Alliierten wiederfinden und erst angesichts dieses aussichtslosen Wahnsinns den Dienst mit dem Satz quittieren: »Kinder, wie hat man uns beschissen!«
Diese Tradition antifaschistischer Filme wollte weniger Antworten geben und mit dem Zeigefinger vom Standort der »Sieger der Geschichte« die Vergangenheit erklären, sondern eine Suchbewegung zur Formulierung einer sinnvollen Frage an die Vergangenheit nachzeichnen. Diese Idee bekam in den 1980er-Jahren eine zusätzliche Herausforderung: Wie behandelt man als junger Filmschaffender eine Zeit, die man selbst nicht miterlebt hat? Wie verwendet man die Mittel des Films, um die Distanz sichtbar zu machen, dass es nicht um den erinnernden Blick eines Zeitzeugen oder die historische Rekonstruktion der Ereignisse geht? Wie drückt man den Wunsch und das Recht aus, als Unbeteiligte, doch von der Geschichte Mitbetroffene und ihr gegenüber Verantwortliche eine eigene souveräne Sicht und Haltung auf sie zu entwickeln?
»Stielke« ist kein Historienfilm und Heinz keine historische Figur. Man sieht nicht das Schicksal, sondern das Abenteuer seines Lebens. Allein die Wahl dieser dramaturgischen Form widersteht dem üblichen Versuch, mit dem besseren Wissen der Zukunft zu erklären, wie damals so etwas von sowas kam. Stattdessen wird die oft rasche, im Geschehen gar nicht sofort nachvollziehbare Entwicklung und Ungewissheit der Ereignisse erlebbar. Wenn Heinz von einer Episode in die andere hastet, wenn wir nicht immer die Zeit haben und in Erfahrung bringen können, was er gerade denkt und fühlt, dann gehört das womöglich zur Ehrlichkeit eines damals 36-jährigen Regisseurs, der uns nicht vormachen will, er wüsste allzu genau, was in einem Jungen vorgeht, der ideologisch verblendet ist und dessen Identität plötzlich die seiner Feinde sein soll.
Viele Presse-Kritiken begrüßten zwar die Absicht, neue filmische Wege zu erproben, um es auch uns unbeteiligten Generationen zu ermöglichen, in der eigenen Vorstellung von den Verbrechen des Nationalsozialismus zu erzählen. Den »Stielke« aber haben sie dann doch verrissen.[7] Nicht immer mit der Attitüde, »dass wir so nicht waren«, aber doch mit dem Ton, dass Abenteuer und Komik, also das verzerrte, entstellte, überspitzte, überraschende, nicht unbedingt gleich lustige Momentum sowie die jugendliche Naivität und Suspendierung der Schuldfrage an einen, so Michael Kann: »Mitläufer, der vom Mitlaufen gehindert wird«, dem Ernst der Vergangenheit unwürdig wäre. Deshalb hatte den Regisseur damals die Stimme eines Lehrers beeindruckt, der zum Schulbesuch des Films aufforderte, weil er eine vom schweren Geschichtsstoff abweichende, aber damit noch lange nicht kolportierte Möglichkeit für junge Menschen schafft, sich heute für die Aufarbeitung der Vergangenheit zu interessieren.
Durch die regen Reaktionen des Publikums am Sonntag hatte ich den Eindruck, dass der Film durchaus mit einer bewegenden Kompensationslast dieser Aufgabe, aber ebenso mit der Erleichterung angeschaut wurde, wie man trotz des schweren Themas auch einmal schmunzeln darf. Der Diskurs war befreiter und das Publikum im Saal zwar ein kleines, aber zweifellos das richtige.
[1] Bereits 1933 hatte das nationalsozialistische Regime damit begonnen, jüdische Schüler:innen systematisch aus öffentlichen Schulen zu entfernen. Das am 15. September 1935 erlassene »Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre« verstärkte auch ohne direkten Bezug zur Schulbildung diese Praxis, indem es einen weiteren »rechtlichen« Rahmen bot. Schulen waren verpflichtet, genealogische Nachweise der Schüler und ihrer Eltern zu überprüfen, um die sogenannte rassische Herkunft festzustellen. Wurde ein Schüler als »jüdisch« oder »Mischling« eingestuft, konnte er von der Schule ausgeschlossen werden, oft unter dem Vorwand, dass seine Anwesenheit die »rassische Reinheit« oder die »deutsche Erziehung« gefährde.
[2] Wolfgang Kellner: Abenteuer wider Willen. Aufbau-Verlag, Berlin (DDR),1984.
[3] https://www.tagesschau.de/inland/antisemitische-straftaten-108.html.
[4] Julia Bernstein: Antisemitismus an Schulen in Deutschland. Bundeszentrale für politische Bildung, Berlin, 2020.
5] Ich verweise an dieser Stelle nur auf den Dokumentarfilm »Die Unsichtbaren – Wir wollen leben«, Claus Räfle, 2017.
[6] Vgl. René Pikarski: Vom Pionier des proletarischen Films zum Begründer der sozialistischen Filmkunst. Slatan Dudow in den Jahren 1946 bis 1963. In: »… und wer wird die Welt verändern?« Slatan Dudow. Bertz+Fischer, Berlin, 2024.
[7] Vgl. umfangreicher Pressespiegel im BArch FILMSG 1/27084.
Merseburger DEFA Filmtage