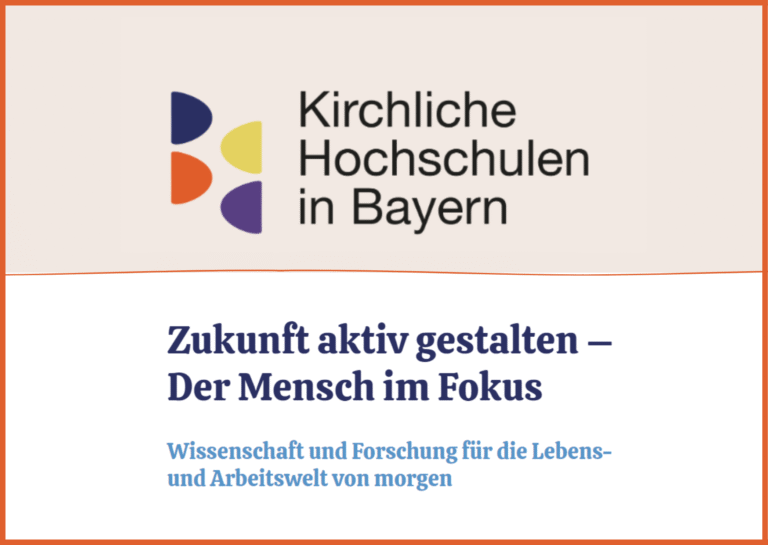Lena Schützle und René Pikarski hatten während eines Workshops des Doktorandenkollegs von Prof. Dr. Michael Reder an der Hochschule für Philosophie München am 27. Juni 2025 die Chance, mit dem Soziologen Prof. Dr. Hartmut Rosa von der Friedrich-Schiller-Universität Jena ins Gespräch zu kommen. In dieser Themenreihe berichten sie von ihrem Austausch.
Zum Beitrag von Lena Schützle
Ein Denkanstoß von René Pikarski
In Resonanzerfahrungen »spricht« uns laut Hartmut Rosa ein Moment der Unverfügbarkeit an, aber auf welche Weise(n) »hören« wir eigentlich zu?
Mit dieser Frage möchte ich Euch in ein kleines Sprachspiel zum Begriff der »Unverfügbarkeit« verwickeln, der für die Resonanztheorie von entscheidender Bedeutung ist. Ich glaube, diese Frage kreist um eine epistemische Herausforderung mit der Unverfügbarkeit, um die die Philosophie nicht so einfach herumkommt. Zumindest dann nicht, wenn sie mit der soziologischen Theorie etwas anfangen möchte, die mit einer so schönen Proklamation beginnt:
»Das Leben vollzieht sich als Wechselspiel zwischen dem, was uns verfügbar ist, und dem, was uns unverfügbar bleibt, uns aber dennoch ›etwas angeht‹; es ereignet sich gleichsam an einer Grenzlinie.« [1]
Lasst mich zum Warmwerden mit der Unverfügbarkeit ein paar Eulen nach Athen tragen und daran erinnern, dass dieser Grenzbereich zwischen einer erotischen und einer erratischen Unverfügbarkeit tiefe Wurzeln in der Philosophie hat. Unser Diskurs ist ja voller spannender Abseitsfallen im Spiel einer attraktiven Unverfügbarkeit, die uns auf- oder anregt mit einer erratischen Unverfügbarkeit, die für uns ein unerschließbares »Nichts« und »Niemand« bleibt, mit dem wir unter Abbruch unserer Spontanität einfach nichts weiter anfangen können: Unverfügbarkeiten, mit deren Erfahrung wir entweder tätig werden oder in dessen Angesicht wir einfach untätig bleiben und die uns vielleicht sogar abstoßen.
Da ist etwa die allererste erotische Unverfügbarkeit als Anfangsmoment der Philosophie: das Nichtwissen, das Sokrates zum Staunen bringt und zur Überwindung dieses Mangels treibt. Da ist aber auch ein An-sich der Dinge, das Kant uns einfach nicht erfahren, aber in der Möglichkeit als notwendig annehmen lässt. In diesem Grenzbereich der Erfahrung geht es außerdem um uneindeutige Dinge, die, wie Derrida meint, das Urteil suspendieren und in der Schwebe halten, weil sie sich einer exakten Diskriminierung und Entscheidung entziehen. Es geht ebenso um Dinge wie lebendige, organismische Prozesse, die sich selbsttätig verändern und die wir laut Whitehead und Bergson diskursiv nie vollständig identifizieren, unter allgemeine Schemata und universelle Kategorien subsumieren können, weil sie sich in dem Moment, wo wir sie begreifen, schon längst in ihrer Eigenbewegung weiterentwickelt haben. Es geht zudem um Dinge, über die wir mit Wittgenstein vielleicht »schweigen müssen«, obwohl gerade sie die eigentlichen Lebensprobleme erst »berühren«.
Grenzerfahrungen des Denkbaren interferieren nun häufig mit denen des Machbaren: etwa, wenn Nietzsche meint, jedes Begreifen sei auch ein schöpferischer, weltmachender, ermächtigender Übergriff oder wenn Heidegger diagnostiziert, das moderne Denken sei eines, das die Welt nur als »Bestand« von technisch verfügbarem Material ergreife: die Welt wird zum »Gestell«. Verliert sie zunehmend ihr Unverfügbares, verliert sie auch die Möglichkeit, für uns die Erfahrung eines anderen Seins zu sein. Die Welt kann uns so nicht länger die Erfahrung eines Andersseins bieten: wir können und wollen ihre uns uneigentliche Eigentlichkeit und ihr spontanes, von uns unabhängiges, d. h. eben unverfügbares Eigenleben nicht mehr erfassen. [2]
Ich glaube, dieses philosophiegeschichtliche Echo erklingt auch dort, wo die Unverfügbarkeit von Hartmut Rosa im soziologischen Phänomenbereich bestimmt und sogar als Moment einer normativen Kritik inszeniert wird: als Phänomen etwa verschiedener Mangelerfahrungen und den Dispositiven ihrer Erzeugung und Überwindung in den Lebensbereichen einer sich bis ins Pathologische hinein beschleunigenden Gesellschaft, die tendenziell darauf hinarbeitet, tote Materie und lebendige »Dinge« häufiger und schneller verfügbar zu machen. Oder eben dort, wo die Unverfügbarkeit Teil eines Rezepts wird, um der zunehmenden Ablösung eines gelingenden Lebens von den vorherrschenden modernen Lebensformen, Lebensweisen und Lebensstilen entgegenzuwirken: Selbst wenn Resonanzerlebnisse keine Entschleunigung versprechen, können sie der Beschleunigung womöglich einen Wert und Rhythmus entgegensetzen, der sich als dialektische Annäherung und Distanzierung zu unseren Habseligkeiten, zum Erreichbaren, Machbaren, Produzierbaren, Kontrollierbaren und Begreifbaren erfassen lässt.
Bevor ich nach dem Wie dieses Erfassens frage, möchte ich noch einmal das zentrale Vokabular zu dem abernten, was da eigentlich erfasst wird. Die Unverfügbarkeit wird uns vorgestellt als notwendiger Aspekt einer Resonanzbeziehung, die zwischen einem Subjekt und seiner Umwelt entstehen kann. Diese Resonanz sei Ausdruck einer für jedes gelingende Leben unerlässlichen Weltbeziehung, bei der sich Subjekt und Welt weder »stumm« noch statisch, sondern in einem »dynamischen Interaktionsgeschehen« gegenüberstehen. [3] Es geht um rhythmische Bezugnahmen und Interaktionen aufeinander, bei denen die jeweilige Eigenbewegung der betreffenden Dinge nie vollständig ausgelöscht wird. Es geht um ein »offenes, vibrierendes, atmendes«, »wechselseitiges Berührt- und Begeistertwerden«, das ein entgegenkommend-anerkennendes anstatt ein zurückweisend-missachtendes Ethos und damit ein sich selbst öffnendes Subjekt ebenso zur Bedingung hat, wie einen welt- und interaktionsoffenen leiblichen und lebendigen Organismus.
Resonanzerfahrungen können weder auf rein kognitive noch rein emotionale Beschreibungen reduziert werden: Wir erleben sie oft als unentschieden zwischen unserem Denken und Fühlen. Wir können in der Regel nicht einmal genau unterscheiden, was an ihnen bewusst und was unbewusst ist. Wir können nicht sagen, was uns dabei synästhetisch bloß zukommt oder was wir mit unserer Einbildungskraft schöpferisch wohl alles hinzutun. Wir können nicht einmal allzu klar aufschlüsseln, bis wohin an diesem »vibrierenden Draht« das Selbst reicht und wo die Außenwelt anfängt. Das gilt auch für das besondere Zeiterleben der Resonanz, da sie eine Weltbeziehung stiftet, während sie sich aufhebt: manchmal hat sie zwar eine stabile Dauer, statisch ist jedoch nie, sie bleibt »das momenthafte Ein- und Auflösen« eines »Begehrens«.
Von hier aus kann man präzisieren: Die Unverfügbarkeit ist eine von vier notwendigen Bedingungen der Resonanzerfahrung. Da sei das Moment der Berührung: mit einem Menschen, Kunstwerk oder einer Landschaft zu resonieren bedeute, von ihnen »inwendig erreicht« und »bewegt« zu werden: Wir werden durch einen »Anruf« in Bewegung gesetzt, wir »fühlen«, dass uns die Welt anspricht. [4] Dann ist da das Moment der Selbstwirksamkeit: die Berührung muss als eine unserem Leib und Geist entsprechende Eigenbewegung erlebt und damit als aktive Antwort auf die Welt zurückgewendet werden können. Zudem gibt es das Moment der Anverwandlung und Transformation: einerseits werden wir durch die Berührung »zu einem anderen Menschen gemacht« und andererseits ändert sich damit auch die Welt (für uns): »eben darin liegt die Erfahrung von Lebendigkeit«, also der Erfahrung eines unverfügbaren, weil unberechenbaren, nicht planbaren gestalterischen Moments der Entwicklung der Beziehungen zu uns selbst, Anderen und zur Umwelt. Einerseits sei die Resonanzerfahrung als Ereignis unverfügbar: sie lasse sich nicht (re)produzieren oder in ihrem Verlauf vorhersagen. Andererseits sei auch der Inhalt einer Resonanzbeziehung nie vollständig verfügbar: Dass etwa ein anderer Mensch »nein« oder »Jetzt nicht« zu uns sagen kann, sei ein ebenso störender wie konstitutiver Moment der Resonanz, wie der zwar unberechenbare, aber nie ganz zufällige, da von mir erwartbare und antizipierbare erste Schneefall. So gilt: »Es kann ein resonantes Gegenüber nur so lange sein und bleiben, wie ich es nicht vollständig begriffen, verstanden und verarbeitet habe.«
Die zur Resonanz »qualifizierte« »Halbunverfügbarkeit« kann also wahrgenommen werden in Relation zum Brennpunkt dreier Erfahrung: der inwendigen Berührung, der Selbstwirksamkeit und der ergebnisoffenen Transformation der Weltbeziehungen. Was aber ist das für ein Modus der Wahrnehmung? Das diskursführende Subjekt der Resonanztheorie gibt uns die folgende Antwort:
»Resonanz ist das (momenthafte) Aufscheinen […] einer Verbindung zu einer Quelle starker Wertungen in einer überwiegend schweigenden und oft auch repulsiven Welt. Deshalb sind Momente intensiver Resonanzerfahrung […] stets auch erfüllt von einem starken Moment der Sehnsucht: Sie bergen das Versprechen auf eine andere Form der Weltbeziehung […]; sie vermitteln die Ahnung von einer tiefen Verbundenheit; aber sie beseitigen nicht die dazwischen liegenden Formen der Fremdheit und der Unverfügbarkeit.« [5]
Schweißperlen für die philosophische Stirn: der Modus des Erfassens resonanter Unverfügbarkeit ist ausgerechnet eine Ahnung, mit der die Erkenntnistheorie seit dem selbsterklärten Übergang vom Mythos zum Logos hart ins Gericht geht. Wir erfassen das Moment der Unverfügbarkeit nicht mit einer einfachen äußeren Sinneswahrnehmung: Womöglich geht es eher um eine Art Zeichen am Sichtbaren, das nicht ohne aktive Deutung oder innersinnlichen, kreativen Eigenbeitrag auf das an ihm haftende Unsichtbare zeigen kann? Wir erfassen das Halbverfügbare auch nicht als erfahrungsunabhängige, unbedingte, zweifelsfreie Gewissheit, die unser Denken beruhigt: Das resonierende Subjekt ist ja in Unruhe und ahnt zudem auf der Grundlage von Lebenserfahrung. Ebenso wenig kann sich die Dialektik der Ahnung vom verfügbaren Unverfügbaren als Wissensgenese qualifizieren, da Wahrheitskriterien oder Bedingungen der Falsifizierbarkeit oder überzeugenden Begründbarkeit in der Resonanzerfahrung offenbar prekär bleiben müssen.
Vielleicht bringt uns ein zweites Zitat auf die Spur zu dieser Ahnung, das mir zwei Anstriche erlaubt, wie wir weiter über sie nachdenken können:
»Gewiss ist diese Art der Wahrnehmung gleichsam auf beiden Seiten oft allenfalls halb bewusst: Wir wissen nicht genau zu sagen, was uns da anspricht und was da in uns darauf reagiert. Zu Erfahrungen dieser Art […] gehört dann aber dennoch erstens das Gefühl einer inneren Verwandlung […] und vor allem: die Vermutung oder auch die Hoffnung, dass es sich lohnen könnte, sich näher darauf einzulassen, sich weiter damit zu beschäftigen, weil wir eben das, was uns da anspricht, noch nicht erschöpfend verstehen oder nicht ausgeschöpft haben.« [6]
Erstens könnten wir die Ahnung mit voller Absicht als epistemisch unzuverlässigen Sammelbegriff für Wahrnehmungen ganz verschiedener Grade der Klar- und Deutlichkeit verstehen. Philologische Herkunft wäre dann der mittelhochdeutsche Ausdruck »es anet mir« und seine Bedeutung »es kommt mich an« bzw. »es kommt über mich«. Damit bekäme die Ahnung ihren zentralen Aspekt des Fühlens und Spürens, das zwar ins Denken eindringt, aber die Schwelle eines Gedankens nie überschreitet, der mit Gewissheit etwas feststellt und begreifen kann. Zudem könnte die Ahnung nach einem sehr präzisen Text von Stefan Willer als »Vorgefühl« und »dunkles Erkennen« [7] oder nach Wolfram Hogrebe als »natürliches Erkennen« [8] durch den ganzen leibgeistigen Organismus verstanden werden, bei dem die betreffenden Sinneswahrnehmungen und Gedanken stets ein lebensdienliches und biografisches Vorzeichen bekommen, also tatsächlich von der Lebenserfahrung und gegenwärtigen Bedürfnissen des erkennenden Subjekts abhängen.
Wenn man mir bis hierhin folgt, wird außerdem ein Zeitvektor jeder Ahnung bestimmbar. Anders etwa, als bei einer Erklärung oder Reflexion bzw. einer »Ahndung« [9], ist die gegenwärtig ahnende Wahrnehmung nicht rückwärtsgewandt, sondern gilt der Zukunft: sie ist ein Vorahnen einer Entwicklung, die entwickelt und entfaltet, »was weiteres darunter verborgen« sein könnte, wie es im Grimm’schen Wörterbuch heißt. [10] So spricht Herder bei der Ahnung von einem »inneren Sinn für die Zukunft«. [11]
Die Unverfügbarkeit der Veränderung meiner Weltbeziehung, die in der Resonanzerfahrung geahnt wird, ist aber keine Deutung eines teleologischen Zeichens (etwa eines unausweichlichen Schicksals). Vielmehr vollzieht dieser innere Sinn eine unsichere, sich aber nun einmal gerade jetzt verwirklichende Zukunft. Das »schöpferische« Antizipieren besteht erst einmal nur darin, dass die Ahnung dem erratisch unverfügbaren Zufall der Zukunft z. B. eine Hoffnung oder, möchte ich mit Luhmann ergänzen, auch eine den Zufall verknappende, weil vertrauensstiftende Maßnahme entgegensetzt: [12] in dem Moment, wo wir unsere zukünftige Entwicklung ahnen, und dabei auf etwas Vages hoffen oder auf etwas Unbegründbares vertrauen, ist für das Ich-Hier-Jetzt zukünftig schon nicht mehr Alles möglich. Mit der Vorahnung macht die qualifizierte Unverfügbarkeit in der Resonanzerfahrung also sowohl eine spontane Verknappung des Verfügbaren als auch eine Verknappung der erratischen Unverfügbarkeit möglich. So aber arbeitet die Ahnung an der Zukunft mit, sie schafft Zukunft, während sie sie erfasst: die Ahnung ist ein Akt schöpferischen Erkennens. Anders gewendet: ihre epistemische Unzuverlässigkeit ist eine Bedingung für die praktische Erfahrung offener Transformations-Chancen.
Mein zweiter Anstrich kreist nun allerdings um den Verdacht, dass die Resonanztheorie der Ahnung noch viel mehr zumutet als das bisher von mir unterstellte. Immerhin soll sich die Ahnung »dialektisch« qualifizieren, sogar eine Quelle der Werte (ein normativer Ursprung) und im Inhalt eine Ahnung vom Leben und Lebendigen sein. Und welcher stärkere, zweifellos nicht weniger problematische philosophische Begriff in der Nachbarschaft der Ahnung verbindet denn traditionell diese drei Aspekte? Das ist die Intuition bzw. das intuitive Erfassen. Nicht die platonisch geschauten Ideen; nicht die Gewissheiten und evidenten Letzteinsichten Descartes‘. Auch nicht die Intuition, die sich für Kant philosophisch einzig dadurch qualifizieren kann, dass sie einem klaren und deutlichen Begriff eine ebenso klare und deutliche Anschauung in Form eines Beispiels, Schemas oder Symbols beibringen kann. Auch nicht die christliche Intuition Schleiermachers als Offenbarungsschau des göttlichen Ewigen.
Womöglich geht es eher um die »jubelnden« und »dämonischen« Intuitionen Nietzsches, mit denen sich das Subjekt nicht nur findet, sondern erfindet; die immer eine wertschöpfende Verwirklichung eines lebendigen Impulses sind und von denen aus »kein regelmäßiger Weg in das Land der gespenstischen Schemata, der Abstraktionen« führt und für die »das Wort nicht gemacht« ist und bei denen wir dennoch nicht schweigen können und »in lauter verbotenen Metaphern und unerhörten Begriffsfügungen« reden, »um wenigstens durch das Zertrümmern und Verhöhnen der alten Begriffsschranken dem Eindrucke der mächtigen gegenwärtigen Intuition schöpferisch zu entsprechen.« [13] Vielleicht geht es auch um die fühlend-denkenden, organismischen Intuitionen Bergsons? Intuitionen, die ebenfalls, wie das mit der Welt resonierende Subjekt, ein »Hineinversetzen« und eine unmittelbare Synchronisation unterschiedlicher, eigenlebendiger Dauern in dem Moment vollziehen müssen, wo diese beginnen, vor dem Hintergrund der Lebenserfahrung zusammen zu schwingen und wenigstens für einen kurzen, seltenen Augenblick »Subjekt und Gegenstand als ineinander übergehend und als heterogene Einheit innersinnlich hervorgebracht werden«? [14]
Ich glaube, diese Fragen und Ideen helfen uns nun dabei, weiter über diese beiden Modi des Ahnens und Intuierens nachzudenken, die für die besondere Art der Wahrnehmung und des Bewusstwerdens von Resonanzerlebnissen Sorge tragen können und sie uns als das erfassen lassen, was sie sind: gelingende und lebendige Übergänge unserer Verhältnisse zu uns selbst und unserer Umwelt.
[1] Rosa: Unverfügbarkeit, S. 8.
[2] In der genannten Reihenfolge: Platon, Theaitetos, 155d; Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 249; Derrida, Die Schrift und die Differenz; Whitehead, Prozess und Realität; Bergson, Schöpferische Evolution; Wittgenstein, Tractatus, § 7 bzw. § 6.52; Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse; Heidegger, Sein und Zeit bzw. »Die Technik und die Kehre«.
[3] Hier und im Folgenden, wenn nicht anders ausgewiesen: Rosa, Resonanz.
[4] Hier und im Folgenden, wenn nicht anders ausgewiesen: Rosa, Unverfügbarkeit.
[5] Rosa, Resonanz, S. 317, Hervorhebung: R. P.
[6] Rosa, Unverfügbarkeit, S. 57f., Hervorhebung: R. P.
[7] Willer, Ahnen und Ahnden. Zur historischen Semantik des Vorgefühls um 1800.
[8] Hogrebe, Ahnung und Erkenntnis.
[9] z. B. jemanden für seine vergangenen Taten ahnden, usw.
[10] Grimms Deutsches Wörterbuch (1854), Eintrag: Ahnen.
[11] Herder, Vom Wissen und Nichtwissen der Zukunft.
[12] Luhmann, Vertrauen.
[13] Nietzsche, Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, 2.
[14] Bergson, Einführung in die Metaphysik, S. 183.