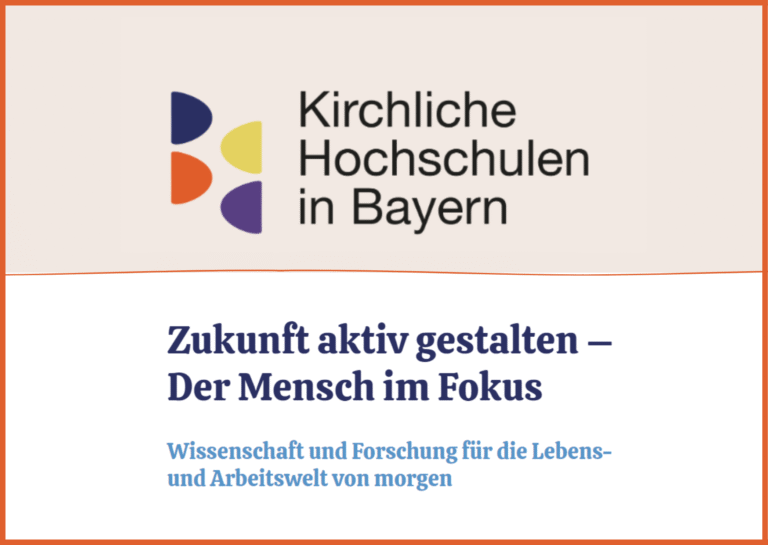Von Andrea Glodek und Marie Neele Ansmann
Als Doktorandinnen im Bereich bzw. der Schnittstelle der Sozialen Arbeit war der Besuch der 14. Konferenz der European Social Work Research Association 2025 an der Katholischen Stiftungshochschule München unter dem Thema „Embracing Democracy in Social Work Practice and Research” für uns ein echtes Highlight. Schon bei der Ankunft spürten wir die besondere Atmosphäre: Wissenschaftler:innen, Forschende, Doktorand:innen und Praktiker:innen aus ganz Europa und der Welt kamen zusammen, um sich über aktuelle Themen, innovative Forschungsansätze und gemeinsame Herausforderungen auszutauschen.
Die drei Konferenztage in München waren gefüllt mit spannenden Vorträgen, intensiven Diskussionen und inspirierenden Begegnungen. Besonders beeindruckt hat uns die Offenheit und Zugänglichkeit der Forschungscommunity – es war ein Raum, in dem auch junge Wissenschaftler:innen gehört wurden sowie wertvolle Impulse einbringen und mitnehmen konnte.
Mit vielen neuen Ideen, Kontakten und einer großen Portion Motivation für das weitere Forschen an unseren Dissertationsprojekten sind wir nach Hause zurückgekehrt – und freuen uns jetzt schon auf die nächste ESWRA-Konferenz in Aberdeen 2026 zum Thema ‚Social Work and Interdisciplinary Research: researching and facilitating evidence informed practice and policy‘.
Zum ersten Mal hatte ich die Gelegenheit, mein Dissertationsprojekt, das sich mit der digitalen Teilhabe älterer Menschen und den unterstützenden Aufgaben von Sozialpädagog:innen beschäftigt, einem internationalen Publikum vorzustellen. Diese Möglichkeit, mein Projekt auf einem Poster zu präsentieren, war aufregend und eine spannende Herausforderung. Ich hatte vorher noch nie wissenschaftliche Themen auf Englisch präsentiert. Die Bedeutung des Themas Digitalisierung ist in unserer heutigen Zeit unbestritten. Ich war aber gespannt, wie mein Forschungsprojekt von anderen bewertet werden würde.
Eine der größten Bereicherungen der Konferenz war der Austausch mit anderen Forschenden. Die Gespräche mit Fachkolleg:innen, die ähnliche Methoden anwenden oder an verwandten Themen arbeiten, eröffneten mir neue Perspektiven. Besonders aufschlussreich waren die Diskussionen über die Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Ich konzentrierte mich auf Vorträge zur Digitalisierung in der Sozialen Arbeit allgemein und zur Wirkung von Digitalisierung auf die Arbeit mit älteren Menschen im Speziellen. Ein zentraler Punkt war, dass digitale Transformation nicht zwangsläufig allen Menschen den Zugang zur Sozialen Arbeit erleichtert. Oftmals profitieren jene, die die Unterstützung am meisten benötigen, am wenigsten von digitalen Angeboten – denn sie verschaffen sich in der digitalen Kommunikation nicht so gut Gehör.
Ein Höhepunkt der Konferenz war für mich das Lernen von den Erfahrungen von Sozialpädagog:innen aus hoch digitalisierten Ländern wie Schweden, Norwegen und Finnland. Diese sind uns bei der Integration digitaler Technologien in die Soziale Arbeit weit voraus, und ihre Erkenntnisse sind von unschätzbarem Wert. Zum Beispiel machte Ida Bring Loberg aus Norwegen darauf aufmerksam, dass mehr Digitalisierung nicht automatisch zu Zeitersparnis führt, sondern oft die Erreichbarkeit und damit die Anzahl der Anfragen erhöht. Clary Krekula aus Schweden thematisierte, wie Menschen mit geringen digitalen Fähigkeiten als „Problem“ betrachtet werden, was ihre Ausgrenzung verstärkt. Niina Rantamäki aus Finnland sprach von „digitaler Armut“, die Menschen ohne Internetzugang gänzlich von Hilfsangeboten ausschließt.
Diese Einsichten unterstreichen die Notwendigkeit, den internationalen Austausch zu fördern, um von den Erfahrungen digitalisierter Sozialstaaten zu lernen. Es ist essenziell, dass Sozialpädagog:innen über digitale Kompetenzen verfügen, um die Digitalisierung aktiv mitzugestalten. Zudem bedarf es einer starken Stimme der Sozialen Arbeit im Digitalisierungsprozess, um dem Menschenrechtsmandat dieser Profession gerecht zu werden.
Insgesamt habe ich von der Konferenz nicht nur viel für meine eigene Forschung mitgenommen, sondern auch Impulse für die praktische Umsetzung in der Sozialen Arbeit erhalten. Die Erkenntnis, dass die fortschreitende Digitalisierung Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich bringt, wird mich in meiner weiteren Arbeit begleiten. Ich freue mich darauf, die gewonnenen Einsichten und Impulse weiterzudenken und bei zukünftigen Gelegenheiten in den Austausch darüber zu gehen.
Als Doktorandin mit einem Dissertationsprojekt an der Schnittstelle zwischen Kunstpädagogik und Sozialer Arbeit eröffnete mir die Teilnahme an der ECSWR 2025 die Möglichkeit, meine Forschung einem breiten, internationalen Fachpublikum der Sozialen Arbeit zu präsentieren, hatte ich doch bislang zumeist auf internationalen Konferenzen des künstlerischen Feldes mein Projekt vorgestellt. Mittels meiner Posterpräsentation zu ‚Art-based practice in social work. Visual Arts in women-specific social work‘ konnte ich in Austausch mit vielen verschiedenen Wissenschaftler:innen treten, mein Forschungsprojekt diskutieren und mich international vernetzen. Durch die vor Ort sowie im Forschungsnetzwerk stark vertretene arts in social work-Community wurde deutlich, wie aktuell und bedeutsam diese Form der Schnittstellenforschung ist.
Wissenschaftliche Debatten, neuer, anregender fachlicher Input sowie Vernetzung unter Forschenden machen für mich den besonderen Reiz von Präsenzkonferenzen aus – Wissenschaftler:innen ähnlicher Forschungsgebiete live zu treffen und spannende, zukunftsweisende Ideen gemeinsam zu entwickeln sowie eigene Forschung zur Diskussion zu stellen – das macht Spaß und treibt Forschung voran. Dies war für mich besonders während meiner Teilnahme an der Veranstaltung der Special Interest Group (SIG) Arts in social work am ersten Konferenztag festzustellen. Das Forschungsinteresse an kunstbasierten Methoden nahm v.a. in den letzten rund 15 Jahren deutlich zu, insbesondere in den internationalen Sozialwissenschaften. Dies zeigte sich auch in den regen Diskussionen und des gut besuchten Angebotes der SIG. In einem kleinen, interaktiven Rahmen war es möglich Forscher:innen des Feldes aus ganz Europa kennenzulernen, über aktuelle Projekte zu sprechen und sich innerhalb der Gruppe zu vernetzen, um beispielweise gemeinsame Forschungsprojekte oder Paper zu verwirklichen.
Insbesondere die Präsentationen und Workshops zur Bedeutung ästhetischer Erfahrung und kunstbasierter, performativer Methoden in der Sozialen Arbeit waren für meine Forschung sehr bereichernd. Besonders eindrucksvoll fand ich die internationalen Panels zu Kunst und sozialer Gerechtigkeit, zu Kunst und Anwaltschaft sowie das Symposium zu internationalen Perspektiven auf verkörpertes Wissen, in dem die Künste als Kanal sozialen Wandels thematisiert wurden. Es wird deutlich, wie vielfältig und vielversprechend das Forschungsfeld und die damit verbundenen Möglichkeiten der Kunst in der Sozialen Arbeit sind. Es zeichnet sich eine Zunahme der Forschungsaktivität der Schnittstelle ab und mit ihr viele neue Erkenntnisse, die im Sinne der forschungsbasierten Praxisentwicklung neue Perspektiven und methodische Ansätze für die Sozialarbeitspraxis liefern.
Mit neuen Ideen und Anregungen für meine Forschungs- sowie Praxistätigkeit als Sozialarbeiterin im Gepäck, habe ich mich am Ende des dritten Konferenztages wieder auf den Heimweg gemacht. Ich habe mich sehr darüber gefreut, mit meinem Forschungsthema schnell Anschluss innerhalb der Community gefunden zu haben und festzustellen, dass Kunst in der Sozialen Arbeit ein zunehmend beforschtes Feld ist, welches innovative und vielfältige Methoden für die Praxis bereitstellt. In jedem Fall blicke ich der nächsten ECSWR erwartungsvoll entgegen, um mich wieder über spannende Forschungsprojekte, Studienergebnisse und natürlich mein Dissertationsprojekt austauschen zu können.